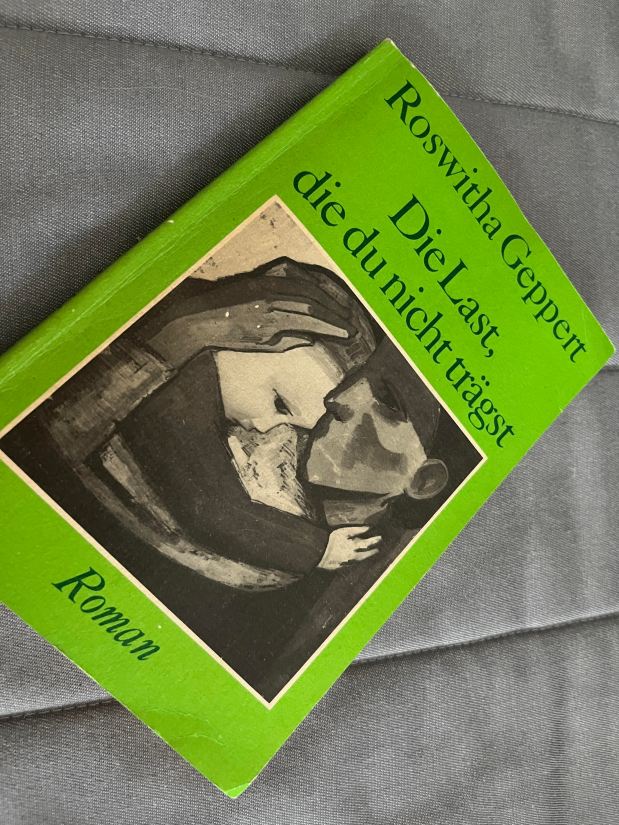Meine erste Berührung mit diesem Buch war im Frühjahr 1980. Ich, zehnjährig, kam mittags aus der Schule und meine damals hochschwangere Mutti saß die sprichwörtlichen Flüssigkeiten heulend auf der Couch im Wohnzimmer, mich gar nicht beachtend, und las in einem dünnen grünen Buch.
„Die Last, die du nicht trägst“. Ein Buch, geschrieben von der Mutter eines geistig schwerbehinderten Jungen. Keiner berühmten oder bekannten Schriftstellerin, einfach einer Frau, die ihren Schmerz, ihre Verzweiflung, ihre Hoffnungen und ihr Erleben in die Erika-Schreibmaschine gehackt hat, damals, 1978.
Ich hatte meine Mutter noch niemals zuvor weinen sehen. Das grüne Buch musste etwas sehr besonderes sein. Ich mopste es mir und las es heimlich. Verstand kaum, was ich las, war entsetzt, heulte gleichermaßen vor Angst und Schrecken heimlich in meine Kinderbettwäsche, und hatte große Angst vor der nahenden Ankunft meiner kleinen Schwester.
Jetzt kann man sich fragen, warum eine Schwangere solch ein Buch liest im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft. Schwangere tun mitunter seltsame Dinge, das wissen wir alle (Ich zum Beispiel war fest davon überzeugt, meine Söhne Titus und Pius zu taufen). Die Wahrheit wird in der DDR-Vergangenheit liegen und dem Umstand, dass es selbst Bücher nicht im angefragten Maße zu kaufen gab und diese „unter der Hand“ weitergegeben wurden. Meine Mutter war eben dran zu einem Zeitpunkt, der für sie ungünstiger (?) nicht hätte sein können.
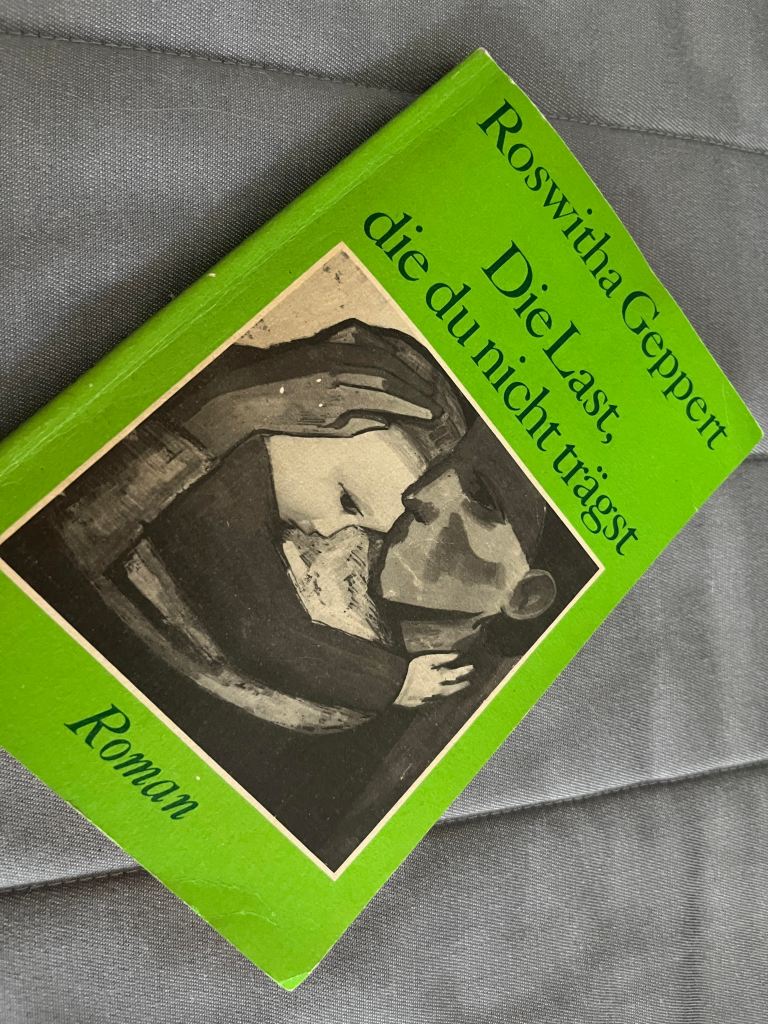
Das dünne grüne Buch wurde in elf Auflagen gedruckt, Roswitha Geppert, die Mutter mit der Schreibmaschine, über Nacht zu einer Bestsellerautorin in der DDR, einer gefragten Ansprechpartnerin für die Belange behinderter Menschen. Ihr Roman hatte nicht nur die öffentliche Diskussion über die Behandlung und Pflege von Menschen mit Behinderung zur Folge, sondern gab den Anstoß auch für andere Eltern, zu erzählen, zu schreiben.
Warum erzähle ich euch das?! Das Buch ist alt, älter als die meisten von euch. Roswitha ist tot, ihr Sohn Tino ist tot, es gibt unzählige Erlebnisberichte von Eltern, die nach ihr kamen. Eltern, die ihr Erleben und Erfühlen in einer Zeit beschreiben, die uns näher ist.
Gerade deshalb.
„Die Last, die du nicht trägst“, ist in ganz vielen Dingen ein Buch, das sich abhebt von allen anderen Büchern, die das Thema aufgreifen.
Zum Einen spielt es in den späten Siebzigern der DDR, es wirft auf seinen vergilbten Seiten einen Blick auf das Leben im Arbeiter- und Bauernstaat, ohne „davon“ erzählen zu wollen. Wir erleben die Kämpfe des Paares um Gleichberechtigung, Wert der eigenen Arbeit, Teilung der sogenannten „care Arbeit“ (den Begriff kannte Roswitha gar nicht), wir erleben, was es heißt: Die Ehe scheiterte an der Belastung der Eltern. Wir lesen, wie der Junge seine Eltern nächtelang um den Schlaf bringt, wie der Vater einen Nervenzusammenbruch erleidet und auf den Rücken seines Sohnes einprügelt und daraufhin die Mutter sitzend und wachend die Nacht am Bett ihres Sohnes verbringt, um den Einen vor dem Anderen zu schützen. Wir lesen uns durch die Gedanken, Kämpfe, Verzweiflungen der Mutter Roswitha in den ersten vier Lebensjahren ihres Wunschkindes. Der eigene Selbstmordversuch wird ebenso wenig ausgespart wie die wachsende Gewalt in der Familie und Abneigung der Umwelt, je größer und „auffälliger“ der Junge wird. Wir lesen, wie die Umwelt auf sie reagiert, auf ihr Kind, zu einem Zeitpunkt, als „solche“ Menschen hinter Mauern und Zäunen geschützt (versteckt) wurden. Wir lesen, wie die Mutter sich Heime ansieht und die Räumlichkeiten, die Bewohner beschreibt, die Zustände, Gerüche, das alles mit einer gewaltig detaillierten Bildsprache. Wir lesen, wie sie versucht zu helfen, mitarbeitet, dort wo niemand arbeiten will. Lesen über ihren Arbeitstag in einem solchen Heim, lesen ihre Geschichte mit, bis sie im Krankenhaus landet aufgrund eines Schwächeanfalls. Und schlussendlich an der Situation kapituliert. An der Last, die sie nicht mehr tragen kann.
Dieses Buch ist das erste seiner Art. Das fühlte ich beim neuerlichen Lesen. Deswegen ist es so besonders. Deswegen möchte ich, dass viele Menschen das lesen! Immer noch.
Roswitha weiß beim Schreiben nicht, dass tausende Menschen ihr Buch jahrzehntelang lesen werden. Roswitha schreibt, was sie denkt, ohne einer Zensur unterlegen zu sein, ohne sich selbst einem Zensus zu unterwerfen. Sie schreibt, ohne ihr Erleben jemals zuvor in dem Erleben einer anderen Person gespiegelt zu sehen. Durch Bücher anderer Eltern, einer Selbsthilfegruppe, dem Internet oder ähnlichem. Sie schreibt auf, was sie sieht, was sie fühlt. Und das liest sich im Jahr 2023 nicht wie ein Buch aus einer anderen Zeit (blendet man verwendete Begriffe wie: „Schwachsinnige“, „Idioten“ etc. aus in dem Wissen, dass das in den Siebzigern gebräuchliches wording war. Ebenso das Wort: „Negerkind“, bei dem ich zusammengezuckt bin).
Dieses Buch ist in meinen Augen so wichtig, weil es ganz viel sichtbar macht. Nicht nur das Offensichtliche, Thematische dieses Buches. Es ist gleichermaßen eine Gesellschaftsstudie, an der man sich anschauen kann, was sich verändert hat, was sich noch immer nicht genug geändert hat.
„Du weißt nicht, wie schwer die Last ist, die du nicht trägst.“, mit diesem afrikanischen Sprichwort beginnt das Buch und die Autorin stellt sich auch der Wahrheit: Was macht es mit meinem Gegenüber, wenn ich ihm schonungslos erzähle, wie es mir geht, auf die harmlose Frage hin: „Wie geht´s dir?“. Was mit meinem schwerbehinderten Kind los ist, wie schwer meine Tage sind, wie aussichtslos. Wenn sie das Erblassen erblickt im Gegenüber, dem sie ungefragt ein Teil ihrer Last vor die Füße geworfen hat. Darf man das?
Sie stellt sich zutiefst ethische Fragen. Ethische Fragen, die die vor ihr niemand wagte zu stellen, die auch im Jahr 2023 aktuell sind.

Ich habe nicht geweint, als ich das Buch in diesem Jahr zum zweiten Mal gelesen habe. Auch nicht bei der berüchtigten „Straßenbahnszene“, die jeder Person im Gedächtnis bleibt, die das Buch kennt. Nein, ich habe das Buch diesmal gelesen als eine Person, die diese Ängste kennt aus dem Erzählen meiner Freundinnen, die Verzweiflung in den Augen anderer schon gesehen hat, der besonderen Frauen in meinem Leben mit ihren besonderen Kindern.
Und ich möchte, dass das Buch von Roswitha Geppert, das fünfundvierzig Jahre alte Buch, von dem ich euch hier erzähle, so viele Menschen wie möglich lesen, um Eltern wie meinen Freundinnen die Last von den Schultern zu nehmen, ein Stück weit zumindest, und zwar durch Verstehen! Um erkennbar zu machen, wir sind weiter gekommen, ja, das sind wir. Aber es bleiben für Außenstehende unermessliche Lasten auf den Schultern der Eltern mit behinderten Kindern, die nicht und niemals von diesen genommen werden können. Jede erreichte monetäre und soziale Erleichterung ist wichtig, aber in meinen Augen viel wichtiger ist, dass echtes Verständnis wachsen kann, für die Last, die du nicht trägst.
In ihrem Buch „Das Lächeln kehrt zurück“, dass immer mal wieder als Fortsetzungsroman betitelt wird (was das Buch nicht ist), schreibt Roswitha Geppert auf Seite 16:
„… Seltsam. Sobald man mit Unbetroffenen ins Gespräch kommt und sie erfahren, das einem das geistig schwerbeschädigte Kind starb, wird die Vermutung laut, dass man darüber froh sein müsste. Oder zumindest erleichtert, von dieser Belastung entbunden zu sein. (…) Stirbt einer Mutter das geschädigte Kind, so stirbt ihr das Kind. Ohne alle Abstriche. Ein Kind, um das sie möglicherweise mehr trauert, als um einen anderen Menschen. Weil dieses Kind ohne ihre Liebe, ihre Fürsorge und mütterliche Selbstlosigkeit niemals lebensfähig gewesen wäre. Freilich, ein Leben in Abhängigkeit, für beide. Aber: bei welchem Menschen sonst bekommt man die Chance, ohne Enttäuschung unendlich zu lieben?…“.
Mir war wichtig, euch von diesem Buch zu erzählen. Ja, wer vielleicht für einen leichten Bonmot, einen schnöden Schenkelklopfer heute hier vorbeigeklickt hat, der mag enttäuscht von dannen ziehen. Aber vergisst vielleicht dennoch nicht den Titel des kleinen grünen Buches.
„Immer bringst du mich zum Heulen!“, schrieb irgendwann eine Leserin mal. Das will ich nicht, jemanden zum Heulen bringen. Zum Lachen bringen, vielleicht. Zum Fühlen bringen, ganz sicher, das will ich. Leben ist etwas wunderbares, Leben zu schenken, Leben zu bewahren. Leben zu schützen, Lasten abgeben zu können, einander Lasten abzunehmen, das gehört dazu. Wertschätzung entgegen zu bringen für die Personen, die sich beruflich, in Selbsthilfegruppen oder ehrenamtlich engagieren, um anderen Menschen ihre Lasten erträglich zu machen, das auch. Und anzuerkennen, dass diese Gabe nicht jedem Menschen gegeben ist. Und das danach in Demut nie wieder zu vergessen. ❤